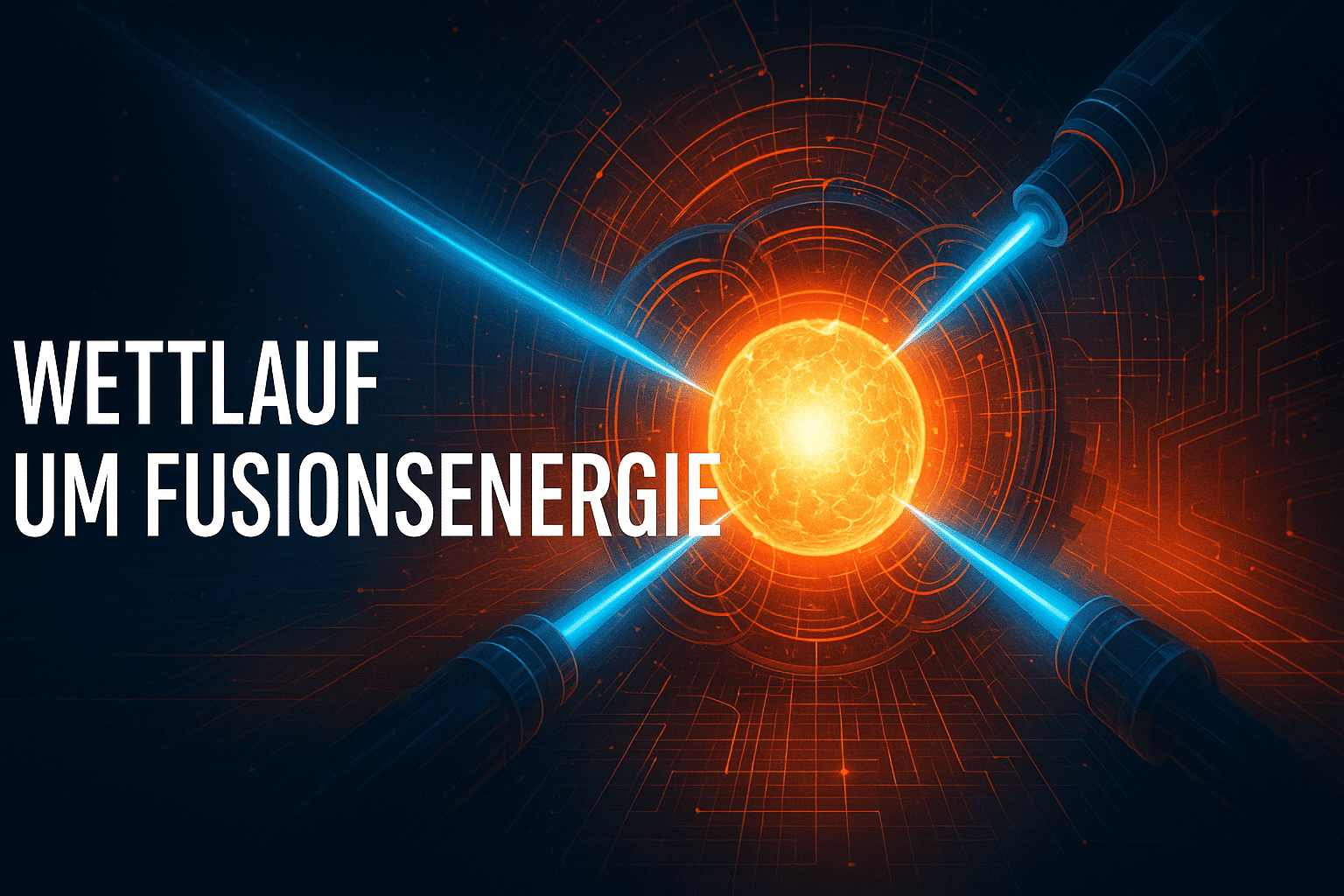Das Münchner Start-up Marvel Fusion will mit einem laserbasierten Fusionskraftwerk 500 Megawatt Nettoleistung erzeugen und so den Traum von unendlicher, sauberer Energie verwirklichen. Doch während weltweit Milliarden in Fusionsprojekte fliessen, stellt sich auch für Versicherer eine zentrale Frage: Wie lassen sich Technologien absichern, die es noch gar nicht gibt und welche neuen Chancen entstehen daraus für Risikomanagement und Kapitalanlagen?
Das 2019 gegründete Münchner Unternehmen Marvel Fusion verfolgt einen Ansatz, bei dem ultrakurze Laserimpulse Atomkerne zur Verschmelzung bringen. Ziel ist ein kommerzielles Kraftwerk mit 500 Megawatt Nettoleistung ab Mitte der 2030er-Jahre: genug, um eine Kleinstadt oder ein Chemiewerk zu versorgen.
Bereits in Bau ist ein Demonstrator in den USA: In Kooperation mit der Colorado State University entsteht ein 150-Millionen-Dollar-Projekt, das die technische Machbarkeit im industriellen Massstab zeigen soll. Die Finanzierung liegt inzwischen bei über 385 Millionen Euro, davon über 170 Millionen in Eigenkapitalrunden.
Marvel Fusion setzt auf die sogenannte Trägheitsfusion (Inertial Fusion), bei der Laserstrahlen ein winziges Brennstoffkügelchen komprimieren, bis dessen Atomkerne verschmelzen. Dabei wird Energie freigesetzt, die dem gleichen physikalischen Prinzip entspricht, das auch in der Sonne wirkt. Der Laseransatz unterscheidet sich deutlich vom stärker verbreiteten Magnetfusionskonzept (Tokamak), das etwa in internationalen Forschungsprojekten wie ITER verwendet wird.
Nach einem erfolgreichen Machbarkeitsnachweis will Marvel Fusion bis 2033 einen Prototyp mit Pilotkunden bauen. Weltweit ist das Startup Teil eines dynamischen Wettbewerbs: Neben Marvel Fusion arbeitet auch das Münchner Unternehmen «Proxima Fusion» an einem eigenen Reaktor und hat im Sommer 2025 rund 130 Millionen Euro Kapital eingesammelt.
Wettlauf, Chancen, Risiken und Zeitrahmen
Die Chancen der Fusionsenergie sind enorm. Sie verspricht nahezu unerschöpfliche Energie, keine CO₂-Emissionen und nur minimale radioaktive Abfälle. Die verwendeten Rohstoffe, wie Wasserstoffisotope, sind auf der Erde reichlich vorhanden und sicher zu handhaben. Sollte der technologische Durchbruch gelingen, könnte die Fusionsenergie die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern beenden und die globale Energieversorgung grundlegend verändern.
Doch die Herausforderungen sind gross. Die Reaktoren müssen Temperaturen von über 100 Millionen Grad Celsius erzeugen und stabil halten. Materialien müssen extremen Belastungen standhalten, und bislang übersteigt der Energieaufwand für die Fusion den Energieertrag. 2022 gelang Forschern in den USA zwar erstmals ein positiver Nettoenergiegewinn, was einen wichtigen Meilenstein bedeutete. Dennoch warnen Experten, dass der Weg zur industriellen Nutzung noch lang ist.
Neue Dimensionen des Risikomanagements und nachhaltige Kapitalanlagen für Versicherer
Für Versicherer ergeben sich aus dieser Entwicklung neue Dimensionen des Risikomanagements. Fusionsanlagen schaffen völlig neue Risikoprofile, die von Materialermüdung über Laserfehler und Kühlmittelausfälle bis hin zu Cyberangriffen auf hochvernetzte Systeme gehen. Die klassischen Modelle aus der Kernenergiewirtschaft lassen sich hier kaum übertragen, da die physikalischen Prozesse und potenziellen Schadenszenarien grundlegend anders sind.
Gleichzeitig entstehen neue Chancen im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen (ESG). Beteiligungen an Fusions- oder Cleantech-Projekten könnten für institutionelle Investoren wie Versicherungen oder Pensionskassen zu einem strategisch wichtigen Bestandteil grüner Portfolios werden. Durch gezielte Investments in Startups oder Fonds, die sich mit Fusions- oder Dekarbonisierungstechnologien beschäftigen, können Versicherer nicht nur Rendite erzielen, sondern auch aktiv zur Energiewende beitragen.
Schweiz mit breiterem Cleantech-Portfolio
Während Deutschland und die USA auf Fusion als Schlüsseltechnologie setzen, konzentriert sich die Schweiz auf ein breiteres Cleantech-Portfolio. Hier steht die sofortige Wirkung im Vordergrund, also Technologien, die CO₂ reduzieren, Energie effizienter nutzen oder fossile Brennstoffe ersetzen.
Das Zürcher Unternehmen Climeworks etwa ist weltweit führend im Bereich Direct-Air-Capture und filtert CO₂ direkt aus der Atmosphäre, um es dauerhaft unterirdisch zu speichern. Neology Hydrogen aus Lutry entwickelt Lösungen, um Ammoniak als sicheren Trägerstoff für Wasserstoff einzusetzen, während Gaia Turbine aus Lugano hocheffiziente Mikroturbinen für Wasserkraftsysteme baut. Das Lausanner Unternehmen Akselos wiederum simuliert mit digitalen Zwillingen die Lebensdauer und Stabilität von Energieinfrastrukturen. Diese Technologie ist für Versicherer besonders interessant, da sie Risiken messbarer macht und präventive Massnahmen erleichtert.
Erfolgversprechende Schweizer Cleantech-Startups
Zu den vielversprechendsten Schweizer Cleantech-Startups zählen laut einer aktuellen Übersicht von Top100 Startups Switzerland: DePoly, Voltiris und Bloom, die sich mit Kunststoffrecycling, Energiegewinnung in Gewächshäusern und nachhaltigen Materialien befassen.
In der Forschung sind das Swiss Plasma Center der EPFL und das Paul Scherrer Institut (PSI) wichtige Akteure. Beide Institute arbeiten an der Grundlagenforschung zur Plasmaphysik und zu Hochtemperaturmaterialien. Dieses Wissen wird für zukünftige Fusionsprojekte essenziell sein.
Robuste Investitionslandschaft
Auch die Investitionslandschaft ist in der Schweiz robust. Zahlreiche Venture-Capital-Fonds, darunter Foundation for Innovation and Technology (FIT), Contrarian Ventures, TiVentures und die Zürcher Kantonalbank, fördern gezielt Cleantech-Unternehmen. Plattformen wie Startup.ch oder der Swiss Cleantech Top 100 Award schaffen Sichtbarkeit und Anknüpfungspunkte für Kooperationen zwischen Startups, Investoren und Versicherern.
Versicherungen mit massgeschneiderten Deckungskonzepten
Für Versicherungsunternehmen eröffnet diese Innovationslandschaft gleich mehrere Handlungsfelder. Zum einen wächst der Bedarf an massgeschneiderten Deckungskonzepten für junge Technologieunternehmen, die hohe Investitions- und Entwicklungsrisiken tragen. Zum anderen entstehen neue Anlageoptionen für nachhaltige Infrastruktur- und Technologiefonds, die langfristig stabile Renditen bei positiver Klimawirkung versprechen. Rückversicherer können zudem durch ihr Know-how im Risikomanagement von Hochtechnologien, beispielsweise aus der Luftfahrt oder der Industrieversicherung, frühzeitig tragfähige Modelle für die Fusions- und Cleantech-Branche entwickeln.
Einschätzung und Ausblick
Marvel Fusion in Deutschland steht beispielhaft für den neuen Energiemut in Europa. Ob das geplante 500-Megawatt-Kraftwerk Mitte der 2030er-Jahre tatsächlich ans Netz geht, hängt von Kapital, Regulierung und internationaler Kooperation ab. Sicher ist: Die Entwicklung der Fusionsenergie wird auch die Versicherungswelt durch neue technische Risiken, aber auch durch attraktive Investitionschancen im Bereich nachhaltiger Energieprojekte verändern.
In der Schweiz setzen Startups und Investoren auf Technologien, die bereits heute Wirkung zeigen: CO₂-Abscheidung, Energieeffizienz, Wasserstoffsysteme und Kreislaufwirtschaft. Damit entsteht ein doppelter Handlungsraum für die Versicherungswirtschaft einerseits als Kapitalgeber im nachhaltigen Umbau der Wirtschaft, andererseits als Risikoträger für eine neue Generation klimafreundlicher Technologien.
Während Deutschland also den Laser zündet, baut die Schweiz die Basis für eine resiliente, emissionsfreie Energiezukunft. Für Versicherer ist das nicht nur ein Beobachtungsfeld, sondern eine Chance, sich frühzeitig als Partner der Transformation zu positionieren.
Binci Heeb
Lesen Sie auch: Overshoot Day: Leben auf Pump wird zur Normalität