Während sich die Welt auf neue KI-Durchbrüche konzentriert, bleibt ein entscheidender Faktor oft unbeachtet: Daten. In der Schweiz und ganz Europa eröffnet der wachsende Bedarf an qualitativ hochwertigen Trainingsdaten neue wirtschaftliche Chancen und stellt alte Besitzverhältnisse in Frage.
Die digitale Transformation ist in vollem Gange, doch die nächste Phase wird durch künstliche Intelligenz geprägt. Weltweit zeigen Entwicklungen, dass KI nicht nur von Rechenleistung und Algorithmen lebt, sondern von Daten. Ohne riesige, präzise strukturierte Datensätze lässt sich keine zuverlässige KI entwickeln.
Was in den USA bereits in grossem Stil geschieht, beginnt nun auch in Europa an Bedeutung zu gewinnen: Daten gelten zunehmend als eigenständige, strategisch wertvolle Ressource. Unternehmen, Hochschulen und öffentliche Institutionen besitzen umfangreiche, oft bislang ungenutzte Datenbestände. Diese gehen von medizinischen Studien über technische Manuals bis hin zu Logistikdaten. Diese Informationen könnten zum entscheidenden Rohstoff der europäischen KI-Wirtschaft werden.
Schweizer Datenräume – ungenutztes Potenzial
Gerade die Schweiz, mit ihrer hohen Dichte an Forschungsinstituten, Versicherungen, Banken und Industrieunternehmen, ist reich an solchen Daten. Doch vielerorts lagern sie fragmentiert in Datensilos, geschützt durch komplexe regulatorische Hürden. Während KI-Modelle in den USA bereits ganze Textsammlungen und Videodatenbanken durchpflügen, stellt sich hierzulande die Frage: Wie lassen sich Daten sinnvoll, sicher und rechtskonform monetarisieren?
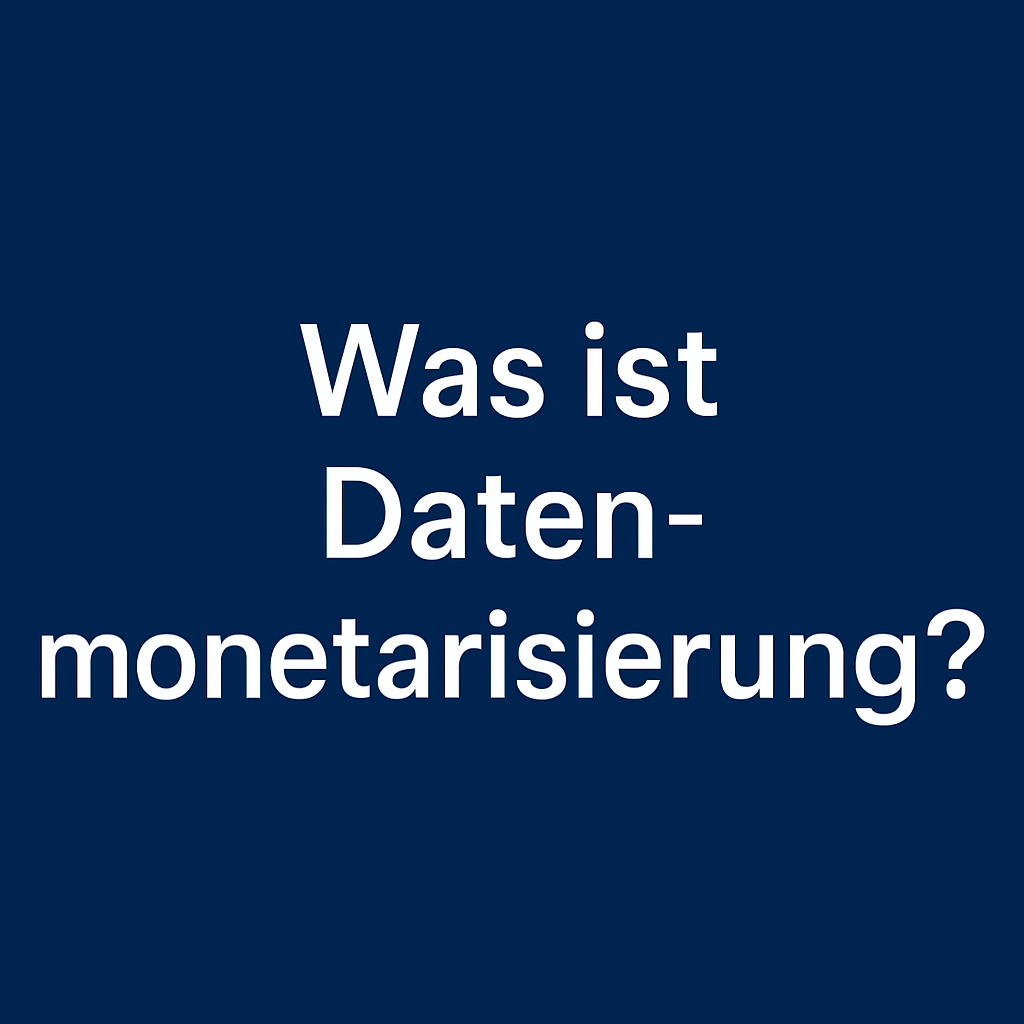
Datenmonetarisierung: wirtschaftliche Nutzung von Daten durch Verkauf, Lizenzierung oder interne Effizienzsteigerung. Im Kontext von KI vor allem: Unternehmen stellen ihre strukturierten Daten Dritten gegen Bezahlung oder im Rahmen von Partnerschaften zur Verfügung.
Formen der Monetarisierung:
- Direkt: Lizenzvergabe an externe KI-Unternehmen oder Forschungseinrichtungen
- Indirekt: Nutzung zur Verbesserung eigener KI-Modelle und Services
- Synthetisch: Erstellung virtueller Datensätze (z. B. durch Simulationen)
Voraussetzungen:
- Datenqualität (strukturiert, dokumentiert, aktuell)
- Geklärte Eigentumsrechte
- Technische Infrastruktur zur sicheren Bereitstellung
Einige Schweizer Hochschulen prüfen derzeit Lizenzmodelle, bei denen wissenschaftliche Datensätze unter bestimmten Bedingungen an KI-Entwickler weitergegeben werden können. Auch Unternehmen aus der Finanz- oder Medizintechnik beginnen, ihre Datenbestände als strategisches Asset zu verstehen, nicht mehr nur als Nebenprodukt der Geschäftstätigkeit.
Synthetische Daten und digitale Zwillinge auf dem Vormarsch
Ein weiterer Trend mit wachsendem Einfluss sind synthetische Daten. Dank digitaler Zwillinge lassen sich komplexe Szenarien simulieren, beispielsweise für die Ausbildung autonomer Fahrzeuge oder zur Optimierung von Lieferketten. Anstelle realer Bewegungsprofile nutzt man digitale Abbilder von Städten oder Prozessen, um KI-Modelle gezielt zu trainieren.
Gerade in der Schweiz, wo der reale Zugang zu grossen Nutzerpopulationen, wie zum Beispiel für Mobilitätsdaten, beschränkt ist, könnten solche virtuellen Alternativen ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Forschungseinrichtungen wie die ETH Zürich oder EPFL Lausanne entwickeln hier bereits entsprechende Simulationsumgebungen.
Dateneigentum und Vertrauen: Europas Herausforderung
Doch bevor der europäische Datenmarkt richtig in Fahrt kommt, müssen zentrale Fragen geklärt werden: Wem gehören die Daten? Wie lassen sie sich fair und transparent lizensieren? Und wie kann man sicherstellen, dass Persönlichkeitsrechte und Datenschutz auch im KI-Zeitalter gewahrt bleiben?
Während US-Konzerne ihre Datenhoheit längst durch vertragliche Exklusivität und technische Plattformen sichern, ringt Europa noch mit ethischen und juristischen Rahmenbedingungen. Initiativen wie GAIA-X oder das Schweizer Projekt Alps Data Space sollen eine vertrauenswürdige Infrastruktur schaffen – bisher jedoch mit begrenzter wirtschaftlicher Durchschlagskraft.
Von der Regulierung zur Innovation
Die Zukunft wird davon abhängen, ob Europa den Spagat zwischen strengen Datenschutzauflagen und innovationsfreundlicher Datenwirtschaft schafft. Unternehmen, die sich frühzeitig mit Fragen der Datenklassifikation, Lizenzierung und strategischen Partnerschaften auseinandersetzen, können hier eine Vorreiterrolle übernehmen.
Nicht zuletzt stellt sich auch eine gesellschaftliche Frage: Wollen wir zulassen, dass Daten nur von einigen wenigen globalen Playern genutzt werden? Oder gelingt es Europa, eigene Datenmärkte mit fairen Regeln, als Gegengewicht zur dominanten Plattformökonomie, zu etablieren.
Die Debatte um künstliche Intelligenz darf nicht bei Algorithmen enden. Die entscheidende Währung der Zukunft sind Daten, und die Fähigkeit, sie sinnvoll, verantwortungsvoll und wirtschaftlich zu nutzen. Für die Schweiz und Europa liegt darin nicht nur ein neues Geschäftsmodell, sondern auch ein strategischer Hebel für digitale Souveränität.
Binci Heeb
Der Artikel basiert auf einer thematischen Weiterentwicklung des Beitrags „Demands for AI data creates new income stream“ von Kim Posnett, erschienen in der Financial Times am 20. Mai 2025. Ergänzt durch eigene Recherchen und eine europäische sowie schweizerische Perspektive.
Lesen Sie auch: Daten, Diagnosen, Durchbrüche – Wie KI das Gesundheitswesen revolutioniert





