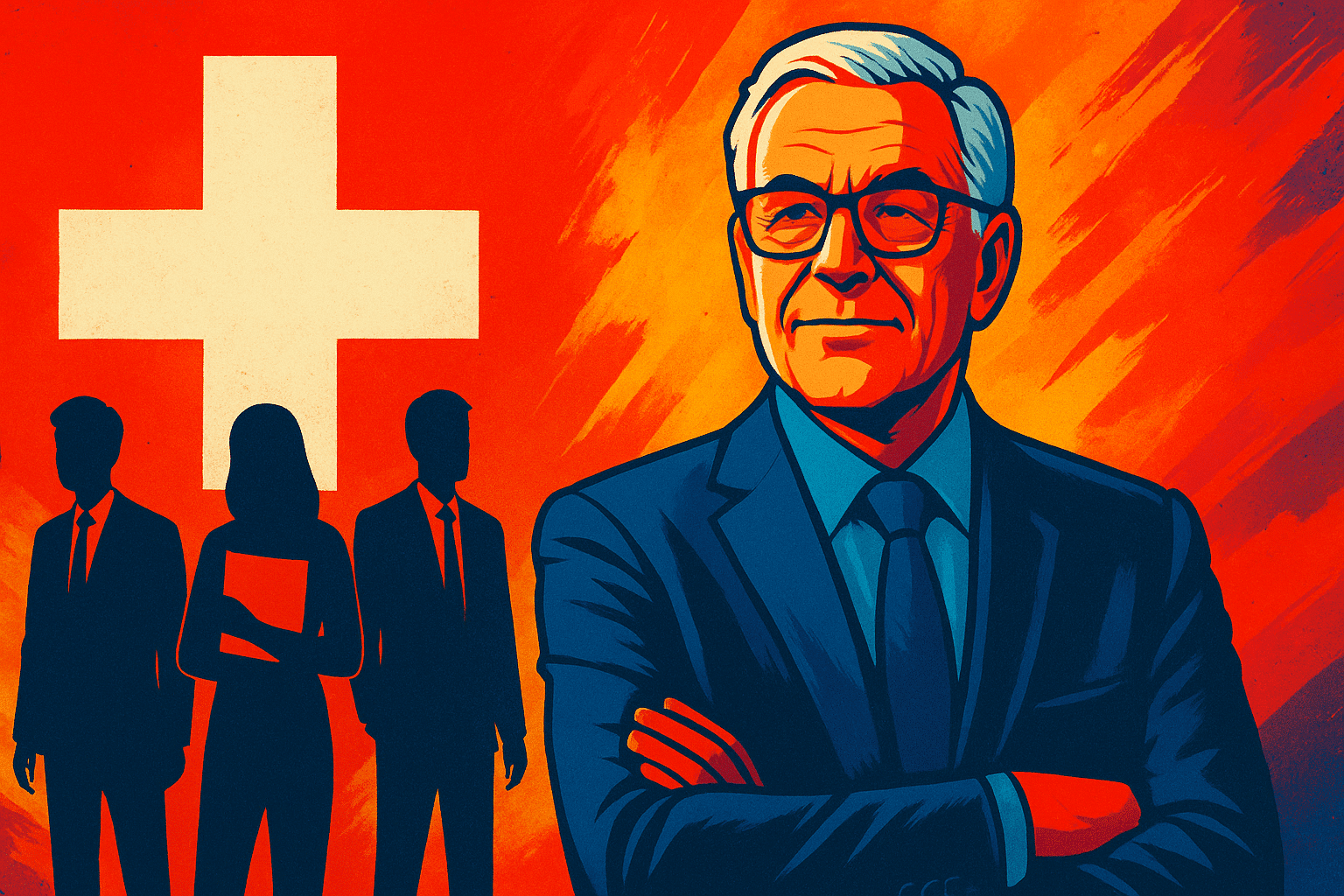Die Schweiz spürt einen massiven Fachkräftemangel, so auch in der Versicherungsindustrie. Statt ausschliesslich auf Zuwanderung zu setzen, entdecken Unternehmen zunehmend eine wertvolle Ressource: erfahrene Mitarbeitende 55+ bringen Know‑how, Zuverlässigkeit und Stabilität ins Unternehmen. Gleichzeitig zeigt sich ein Spannungsfeld bei den Jüngeren: Unternehmen erwarten Pünktlichkeit, Teamfähigkeit und digitale Grundkompetenzen, während einige Schulabgänger diese nicht ausreichend mitbringen. Umgekehrt wünschen sich viele Jugendliche flexible Arbeitszeiten und schnelle Aufstiegsmöglichkeiten, Erwartungen also, die klassische Lehrstellen oft nicht erfüllen. Dieses Missverhältnis trägt dazu bei, dass tausende Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben.
Bis 2030 könnten in der Schweiz rund 500 000 Erwerbstätige fehlen, mit der Perspektive auf 1,3 Millionen bis 2050. Dies ist eine Folge stark geburtenschwacher Jahrgänge und massiver Babyboomer-Pensionierungen. Im Gesundheitswesen, etwa bei Pflegefachkräften, könnten schon bis 2030 17 000 neue Stellen geschaffen und weitere 60 000 Stellen durch Altersabgänge neu gefüllt werden müssen.
Boomer als Ressource: Erprobte Potenziale in anspruchsvoller Zeit
Laut Swiss Life-Studie betrachten 22 Prozent der Unternehmen gezielt das Einstellen von älteren Mitarbeitenden (55+) als Strategie gegen Fachkräftemangel. Obwohl 23 Prozent der Erwerbstätigen dieser Altersgruppe angehören, machen sie nur 8 Prozent der Neueinstellungen aus. Viel Potenzial bleibt ungenutzt.
Warum ist das so? Ältere Mitarbeitende punkten mit Krisenerfahrenheit, Praxiswissen und hoher Loyalität, also mit qualitativen Pluspunkten, die im dynamischen, oft digitalen Arbeitsmarkt immer seltener zum Standard zählen.
Junge Generation: Zwischen Anspruch und Qualifikation
Parallel zur wachsenden Nachfrage nach Erfahrung bleibt ein wachsendes Missverhältnis bei jungen Bewerberinnen und Bewerbern bestehen: Trotz hoher Erwartungen der Unternehmen bleiben tausende Lehrstellen unbesetzt. Das SECO schätzt etwa 12 000 unbesetzte Ausbildungsplätze im Jahr 2024. Das bedeutet, dass junge Menschen ohne Platz bleiben, während Betriebe offene Stellen haben, weil Qualifikationen, wie Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, digitale Grundkompetenzen und Motivation fehlen.
Arbeitsklima vor Lohn
Schweizer Erwerbstätige legen mehr Wert auf ein gutes Arbeitsklima als auf den Lohn. Laut einer Studie von swissstaffing und gfs-zürich (1’204 Befragte) nannten 68 Prozent das Arbeitsklima als wichtigste Priorität, gefolgt vom Lohn (63 Prozent). Zeitliche oder örtliche Flexibilität ist für fast die Hälfte unverzichtbar. Die Generationen unterscheiden sich jedoch deutlich: Generation Z strebt Sicherheit und faire Bezahlung an, während die Generation 50+ vor allem Autonomie, Sinnhaftigkeit und flexible Arbeitsmodelle schätzt.
Eine parallele Befragung von 509 Unternehmen zeigt eine Diskrepanz: Nur 53 Prozent betrachten ein gutes Arbeitsklima als Stärke, 44 Prozent die Vergütung. Viele Firmen betonen stattdessen interne Strukturen wie flache Hierarchien als Faktoren, die Beschäftigten weniger wichtig sind. Angesichts des Fachkräftemangels müssen Unternehmen ihre Strategien anpassen: Arbeitsklima, faire Bezahlung und Flexibilität werden zu entscheidenden Erfolgsfaktoren. Auch Personaldienstleister gewinnen an Bedeutung, da sie Unternehmen mit temporären Lösungen und Talent-Pools helfen, Engpässe zu überbrücken und Fehlbesetzungen zu vermeiden.
Unternehmensstrategie: Boomer einbinden – aber wie?
Mehr Firmen erkennen inzwischen den Wert erfahrener Kräfte: 58 Prozent der befragten Unternehmen nennen sie als entscheidenden Faktor im Kampf um Fachkräfte. Firmen setzen auf Modelle wie Tandem‑Programme 50+, Mentoring oder flexible Übergänge in Teilzeit, wie im Kanton Aargau. Allerdings fördern nur 13–14 Prozent der Unternehmen eine Weiterarbeit über das Rentenalter hinaus, obwohl viele ältere Erwerbstätige dies positiv sehen.
Politik & Rahmen: Reformbedarf und Chance
Politisch werden Modelle diskutiert, die Arbeiten im Rentenalter, z. B. durch steuerliche Anreize oder erleichterte Weiterarbeit nach dem 65. Lebensjahr attraktiver machen. Gleichzeitig wird die Strategie der Zuwanderung geprüft, doch ab 2026 könnte diese stagnieren oder sogar sinken, während gleichzeitig viele Babyboomer aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Damit wird das Inlandpotenzial, vor allem bei Frauen, älteren Erwerbstätigen und bestehender Bevölkerung, immer zentraler.
Die Chance Schweiz: Wie Unternehmen profitieren können
| Strategie | Wirkung |
|---|---|
| 55+ aktiv rekrutieren | Erfahrene Mitarbeitende füllen Lücken |
| Weiterarbeit fördern | Potenzial länger nutzbar machen |
| Junge fördern und integrieren | Ausbildungsplätze passgenau besetzen |
| Flex- & Teilarbeit anbieten | Für ältere Mitarbeitende attraktiver |
Viele Arbeitgeber erkennen heute: Wer ältere Mitarbeitende lediglich als Belastung sieht, verschenkt gerade in Zeiten, in denen Fachkräfte Wachstum und Innovation sichern, strategische Assets.
Das Referenzalter der Frauen wurde ab dem 1. Januar 2025 schrittweise um jeweils drei Monate an dasjenige der Männer auf 65 Jahre angepasst. Ab Anfang 2028 gilt für alle das Referenzalter 65. Internationale Organisationen wie die OECD empfehlen, das Referenzalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Die Faustregel besagt: Steigt die Lebenserwartung um 1 Jahr, erhöht sich das Rentenalter um 8 Monate.
Rente mit 70?
Für die Schweiz würde das Folgendes bedeuten: bei einer angenommenen Lebenserwartung von zusätzlich 5 Jahren bis 2050, was eine realistische Berechnung ist, müsste das Rentenalter auf 67 bis 68 Jahre steigen, um die Finanzierungsbasis zu stabilisieren. Bei gleichzeitigem Rückgang der Bevölkerung und damit weniger Beitragszahlern, wäre sogar ein Referenzalter von 70 Jahren bei fitten Personen denkbar, falls keine anderen Massnahmen, wie Einwanderung, höhere Beiträge oder tiefere Renten greifen.
Wenn die Bevölkerung schrumpft, die Lebenserwartung weiter steigt, und das heutige Rentenniveau beibehalten werden soll, müsste das Referenzalter langfristig auf mindestens 67 Jahre, eher 68–70 Jahre angehoben werden.
Die Kombination aus demografischem Wandel, ungenutzten Potenzialen der Boomer und fehlender Zuwanderung macht die Integration älterer Mitarbeitender zum entscheidenden Ansatz. Unternehmen, die sie strategisch fördern, beispielsweise über flexible Modelle, Weiterbildung oder Rentenregelungen, sichern sich Wettbewerbsvorteil und Zukunftsfähigkeit.
Binci Heeb
Lesen Sie auch: Arbeit über das Pensionsalter bei Versicherern und Brokern